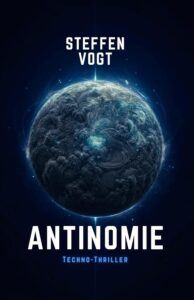Schon der enigmatische Titel von Steffen Vogts im Eigenverlag erschienenen Debüt-Roman wirft unbedarften Leser*innen Fragen auf: Was ist eine Antinomie? Aus dem altgriechischen kommend, bezeichnet der Begriff eine Art des logischen Widerspruchs, einen unauflösbaren Widerstreit der Gesetzmäßigkeiten – die sich im Gegensatz zu einer Paradoxie in einer Weise widersprechen, die schon im System verankert ist. Wie sich dieser unlösbare Widerspruch in der Handlung des Romans äußert, wird erst ganz zum Schluss enthüllt, ist aber Grundlage für eine meines Erachtens hervorragend geschriebene und vor allem sehr gut getimte Tour de Force, die stimmungsmäßig zwischen ebenso technischer wie fordernder Science Fiction, global angelegtem Agenten-Thriller und fast schon zärtlicher, behäbiger Coming-of-Age-Story im beschaulichen Schwarzwald oszilliert.
Steffen Vogt schafft es Szenarien zu entwerfen, die sich gleichermaßen übernatürlich und doch authentisch anfühlen, mit einem sympathischen und größtenteils nahbaren Figuren-Roster, der einem ans Herz wächst, und Inszenierungsformen, die durchaus auch filmisch anmuten. Ich hab mich manches Mal dabei ertappt gefühlt, mir vorzustellen, wie Antinomie als Netflix-Serie ausschauen würde und mit welchen Schauspieler*innen ich die Figuren casten würde. Und das ist ja in der Regel ein ganz solider Indikator für ein emotional mitnehmendes Buch.
Das Kleine und das Große
1961 – Ein heißer Sonne im entlegenen Little Rock, Iowa – vier junge US-Amerikaner planen eigentlich einen gemütlichen Abend beim Baseball mit gegrillten Hacksteaks und kühlen Bierchen. Die flirrende Luft riecht nach Heu und zerschmelzendem Asphalt. Vom Kalten Krieg, der zwischen den USA und den UdSSR tobt, ist heute Abend nicht viel zu spüren. Und auch als sich ein Regenschauer aus einer vorbeiziehenden Ambosswolke über die trockenen Weiten Iowas ergießt, kann das die gute Stimmung der Freunde nicht trüben. Ungemütlich wird es erst, als sich ein vermeintlicher Tornado bildet – doch irgendwas scheint nicht normal: Im Zuge des Twisters wird die Szenerie von tiefer Finsternis verschlungen, die Windhose artet zunehmend zu „windgewordenem Zorn“ aus, der alles nimmt. Ein geräuschloser schwarzer Blitz markiert das Ende – es ist das Ende der vier Freunde, es ist das Ende der Landschaft, die im Anschluss nur noch von einer schwarzen, glasigen Oberfläche gesäumt wird – später erfahren wir, dass es sich um Quarz-ähnliches Gestein namens Stishovit handelt – und das schlagartige Ende des verheerenden Sturms, der später als sogenannter „Black Storm“ Bekanntheit erlangt. Die Passage dient als Auftakt für eine Geschichte, die sich über mehrere Kontinente und viele, viele Dekaden erstreckt.
Ab diesem Zeitpunkt verfolgt der Roman drei Handlungsstränge, die sich lange Zeit nicht berühren und die das Kleine mit dem Großen verbinden: Wir haben auf der kleinsten Ebene die mit Mystery-Elementen angereicherte Sozialisationsgeschichte des nachdenklichen Waisen Jan Morgen, der in einem Heim im ländlich geprägten Schwarzwald aufwächst, nachdem er als Kleinkind im Jahr 2004 vor der Einrichtung abgelegt wird, und der sich mit den typischen Teenager-Problemen rumschlagen muss, bis er eines Tages seltsame Teleportations-Fähigkeiten entwickelt. Und es ist klar: Derlei Fähigkeiten machen so eine Pubertät mit all ihren Identitätskrisen nicht gerade einfacher.
Der zweite große Handlungsblock betrifft eine fiktive US-Geheimorganisation namens SUP (kurz für Subsection Unexplained Phenomena), die, der Name ist Programm, unerklärliche Phänomene untersucht. Sie wurde im Zuge des „Black Storms“ in Iowa gegründet, seit welchem sich die Gamma-Hintergrundstrahlung überall auf der Welt verdoppelt hat. Die Agent*innen der SUP, die irgendwie als Subsection des CIA bezeichnet wird und doch vollkommen autark agieren kann, sind keine athletischen James Bonds oder Ethan Hunts, sondern übernehmen als sogenannte Gesetzte zunächst eine Schläfer-Funktion, bis sie im Rang zum Special Agent aufsteigen. Sie führen gewöhnliche Leben. Hier lernen wir die US-Amerikanerin Leo Vega kennen, eine junge Frau, die zunächst in Marburg ausgebildet wird. Als vermeintliche Versicherungsmaklerin der Infinity Insurance Company soll sie US-Bürgerinnen mit Versicherungsanliegen helfen. Doch das ist nur (tatsächlich praktizierte) Tarnung – denn die SUP untersucht vor allem sogenannte Items, die physikalische Gesetzmäßigkeiten aufzuheben in der Lage sind, und die für manchmal seltsame, in der Regel aber auch höchst gefährliche Anomalien verantwortlich sind.
Und damit kommen wir zum dritten Block: Denn mit dem Inkrafttreten von Jans widernatürlichen Fähigkeiten häufen sich die Anomalien auf der Erde, und die Gamma-Strahlung wächst kontinuierlich. Bei den auftretenden Anomalien hüpft die Handlung gerne mal über den Erdball. Ob das norddeutsche Cuxhaven, Chisinau in Moldawien, Faro de Mahón auf Menorca oder das portugiesische Aljezur. Zwar wird erklärt, dass vor allem der europäische Kontinent betroffen ist, aber auch andere Teile des Globus bleiben hier nicht verschont. Die Anomalien, die Vogt beschreibt, wirken in ihrer Konzeption extrem kreativ, teilweise in ihrer verheerenden Wirkung grausam, aber nie so abgehoben, dass man das Werk im Bereich der Fantasy verorten würde.
Diese drei Eckpfeiler sind natürlich unmittelbar miteinander verbunden: Denn es stellt sich unweigerlich die Frage, auf welche Weise Jan mit seinen neu errungenen Fähigkeiten in Verbindung mit den Anomalien steht, woher der Junge überhaupt kommt. Und natürlich ist eine sinistre Geheimorganisation mit besonderem Interesse an unerklärlichen Phänomenen nicht weit entfernt, wenn Menschen urplötzlich Superhelden-artige Fähigkeiten entwickeln.
Nun habe ich die Zwischenüberschrift „Das Kleine und das Große“ getauft – denn der Roman fühlt sich einerseits intim und bodenständig an, auf der anderen Seite überlebensgroß. Das ist eine Dualität, die sich durch den ganzen Roman hinweg zieht: Der Roman mutet zugleich urdeutsch und international an, die Provinzialität des Schwarzwalds und meinetwegen Mittelhessens wird konterkariert von den global umspannenden Auswirkungen der Anomalien und den Aktivitäten der SUP. Und auch die manchmal unerwarteten Gewaltspitzen wirken innerhalb der ruhigen Erzählweise wie Indikatoren für den Einfall des Großen ins Kleine.
Die Geschichte um Jan und seine Freunde im Schwarzwälder Waisenhaus fühlt sich behäbig und heimelig, fast schon ein bisschen unschuldig an, es ist ein kleiner Mikrokosmos mit vertrauten Personen. Selbst als Jan seine Fähigkeiten erhält, lehnt er sich nur selten aus dem Fenster und bleibt so lange Zeit unter dem Radar. Es ist eine Umgebung, die auf Konstanten beruht. Die gutherzige Haushaltshilfe des Waisenhauses, Hilde, etwa ist für Jan etwa das nächste, was an eine Mutter herankommt. Und mit Angi und Michel hat er zwei sehr gute Freunde für’s Leben gefunden. Selbst der strenge Leiter des Heimes, Klaus Weilauer, wirkt trotz anstrengender Sorge um Jans Zukunftsperspektiven wie ein guter Kerl. Und auch die vermeintliche Dorfverrückte, das Funkelmariechen, ist ein fixes Element in Jans Alltag. Es ist ein Ort, in dem schon die Feiern im rustikalen Schwarzwälder Gebirgsverein ein Ausbruch aus dem gewohnten Trott bedeuten. Später baut Jan noch zarte romantische Bande zu der anfangs reservierten Emma. All diese Charaktere sind bodenständig und authentisch charakterisiert, es gibt hier niemanden niemanden, der unsympathisch oder übertrieben rüber kommt. Jan wirkt wie ein nachdenklicher, sensibler und äußerst kluger Junge, welcher seiner Melancholie ein Stück weit mehr erliegt, als seine Peers. Selbst die Beziehung zu seinem Love Interest Emma kommt ohne großes, künstlich aufgebauschtes Drama daher.
Umso überraschender ist es, wenn das Buch im späteren Verlauf den ein oder anderen gänzlich unerwarteten Twist in diesem Gefüge offenbart.
Das Buch geht, mit Blick auf die Spannungskurve, nicht direkt in die Vollen. Man muss als Leser*in ein wenig Geduld aufbringen, denn das Buch lässt sich viel Zeit, um die Verbindungen zwischen den Handlungssträngen aufzubauen und auch für die technischen und gesellschaftlichen Hintergründe. Gerade aber das letzte Drittel zieht tempomäßig merklich an und belohnt mit einem realistischen, mitnehmenden Weltuntergangs-Szenario, das merkwürdig greifbar und beängstigend wirkt.
Referenzen zwischen Stalker und Andreas Eschbach
Ich bin mir oft nicht sicher, wie sehr man als Autor*in hören will, welche Referenzen man als außenstehende Person meint, aus einem Werk herauszulesen. Für mich als Leser ist es aber durchaus eine willkommene Orientierungshilfe, wenn ich in Besprechungen derartige Verweise sehe.
Ich habe mich bei der Lektüre konkret an mehrere Schriftsteller*innen und Werke erinnert gefühlt: Antinomie ist hervorragend recherchiert, wirkt beim World Building kohärent und fundiert, und verzahnt ein Abbild unserer realen Welt mit ihren gesellschaftlichen, politischen und historischen Gegebenheiten mit fiktiven (zumeist wissenschaftlichen) Elementen, die sich aber dennoch authentisch anfühlen. Hier sehe ich einige Parallelen zu Andreas Eschbach.
Der ganze Teil um den Aufbau der SUP hat mich phasenweise aber auch an Stieg Larsson und seine originäre Millenium-Trilogie (Verblendung, Verdammnis, Vergebung) erinnert, speziell um den Handlungsstrang der geheimen „Sektion für spezielle Analyse“ innerhalb des schwedischen Nachrichtendienstes SÄPO.
Die SUP ist hier dann aber auch ein gutes Stichwort: Denn die weltweit auftretenden Anomalien und im späteren Verlauf die hohe Dichte an „Items“, Objekten mit besonderen Fähigkeiten, die munter auf dem Schwarzmarkt kursieren, und deren Handel behördlich eingedämmt werden muss, erinnerte mich an ein Werk, wegen dem ich gewissermaßen überhaupt auf Antinomie aufmerksam geworden bin: Der 1971 erschienene Sci-Fi Roman „Picknick am Wegesrand“ von Arkadi und Boris Strugatzki wurde von Tarkovsky als „Stalker“ verfilmt. Dort sind nach einem außerirdischen „Besuch“ an sechs Stellen auf der Erde sogenannte „Zonen“ errichtet worden, die ebenfalls durch Anomalien geprägt sind, die scheinbar den Gesetzen der Physik zuwider sind. Die sogenannten Schatzsucher oder Stalker bergen aus diesen Arealen „Artefakte“, die den „Items“ in Antinomie nicht unähnlich sind, und ebenfalls mit mysteriösen Eigenschaften behaftet sind. Das Thema nimmt hier natürlich eine wesentlich beiläufigere Rolle ein, es gibt aber inhaltliche Schnittpunkte.
Die Coming-of-Age Komponente des Buches wiederum erinnert mich, zumindest in gewisser abwegiger Weise, teilweise an die ersten fünf Harry Potter-Bände, die ja ein großes Augenmerk auf Harrys Sozialisation in Hogwarts legten und die innerhalb der Schulmauern ein enges Figurentableau etablierten – mit seinen engen Freunden und Bezugspersonen. Aber auch ein bisschen Stephen King-DNA ist präsent. Es ist der Einbruch des Übernatürlichen, des Unkontrollierbaren und zuweilen Grausigen ins Normale. Die Ausbildung der übernatürlichen Kräfte von Jan und einer weiteren zentralen Figur, die in der Wizarding World von Harry Potter natürlich eher die Norm wären, erinnern hier ob ihres wissenschaftlichen Hintergrunds vielmehr an die Graphic Novel „Watchmen“ von Alan Moore, und dann speziell an den Charakter Dr. Jonathan Osterman alias „Dr. Manhattan“.
Die in der Presse benannten Dan Brown-Ähnlichkeiten kann ich indes eher weniger nachvollziehen. Natürlich, auch ein Dan Brown suggeriert Authentizität durch Fiktion, die von kunsthistorischen oder wissenschaftlichen Triftigkeiten umrahmt wird und baut daraus Schnitzeljagden um die ganz großen Menschheitsgeheimnisse. Aber a) ist das Tempo in Dan Brown-Stories deutlich höher; die in der Realität verhafteten Themen sind bloße Buzzwords für eine Inszenierung, die oft cineastisch bis videospiel-artig aufgebaut ist und b) ist die Erzählstruktur und auch sprachliche Gestaltung in Antinomie wesentlich komplexer.
Technischer und zugleich nahbarer Schreibstil
Stilistisch ist Antinomie durchaus fordernd geraten. Das liegt nicht etwa an einem zu prätentiösen Stil, der bewusst unzugänglich geraten ist. Im Gegenteil: Steffen Vogt bemüht sich außerordentlich darum, die Szenerien so griffig wie möglich zu beschreiben. Und tatsächlich gelingt ihm das auch wirklich gut: Ich konnte mir jede Figur, jedes Set und jede Szene visuell wirklich vorstellen. Auch die Dialoge erschienen mir weitgehend natürlich, ungekünstelt und haben einen guten Fluss. ABER: Satzstrukturen und Wortwahl sind immer eine kleine Spur zu komplex für’s Genre. Es gibt durchaus den einen oder anderen Bandwurmsatz mit dem einen oder anderen Nebensatz zu viel. Zudem gibt es viele aktuelle Verweise der letzten Jahre, auf die Covid-Pandemie, auf KI-Modelle, auf gesellschaftliche Themen, die nicht allzu nennenswert erklärt werden. Mir persönlich hat das super gefallen, weil die Handlung dadurch sehr realistisch und geerdet wirkt.
Allerdings hatte ich Antinomie nach dem Auslesen meinem Vater geliehen, welcher ein typischer Ü60 Spätaussiedler ist, der gerne „Bahnhofskrimis“ liest – also so Kram von John Katzenbach, Simon Beckett und eben auch gerne Dan Brown – seiner Aussage zufolge hatte er oft Mühe, der Handlung zu folgen, weil er mit den vielen Querverweisen, der Wortwahl und den wissenschaftlichen Elementen gehadert hatte, für die er immer ein Mü zu viel Konzentration aufbringen musste.
Eine Beispielpassage, die ich hier jetzt ohne Kontext anführe, und welche die Kritik ein bisschen verdeutlichen soll:
„(…) Einige Stunden später hatte Rubsky die Fernerkundungsalgorithmen eingeschaltet und die KI mit einem Random-Forest Algorithmus angewiesen, die nun von allein agieren konnte. Der Computer suchte eigenständig alle Bildpixel im Video, die sich anhand schnell ändernder Parameter hervorhoben. Einige Möwen waren schnell ins Bild geflogen, sodass die Pixelklassifizierung sie als rot markierte.“
Super inklusiv und in finaler Konsequenz mainstreamig ist der Schreibstil aber nicht. Natürlich lädt das Ding exemplarisch erstmal ein, nach dem Random-Forest Algorithmus zu recherchieren, ein Verfahren, dass fixer Terminus im Bereich des maschinellen Lernens ist. Vogt erklärt aber explizit nicht. Dadurch ist es zuweilen schwierig auszumachen, welche technische Beschreibung nun einen realen Background hat, und welche im Bereich des sogenannten „Technobabbles“ zu verorten ist.
Eine andere Sache, die ich ironischerweise angenehm, aber durchaus auch befremdlich fand: Der Coming-of-Age Part um Jan Morgen wirkt irgendwie aus der Zeit gefallen. Die Jugend von Jan, Angelica und Michel erschien mir merkwürdig analog – Smartphones und Social Media spielen keine nennenswerte Rolle. Die Art der Kommunikation zwischen den Freunden mutet merkwürdig „intakt“ an – aktueller Jugendslang oder Meme-Kultur findet hier einfach nicht statt. Pubertäres Drama hält sich in Grenzen und Freundschaft und Mitgefühl sind hier natürlich gegebene Maximen. Zynisch wie ich mittlerweile bin, fühlte sich das ganze Setting ein wenig „christlich aufgeladen“ an. Zugleich aber hatte der ganze Part aber auch was wehmütig-nostalgisches an sich. Ich hatte beim Lesen ähnliche Gefühle wie beim Konsum des Filmes „Stand By Me – Das Geheimnis eines Sommers“.
Zugleich merkt man an durchaus einigen Stellen, dass Steffen Vogt studierter Geograf ist. Insbesondere ist mir das bei der Beschreibung von Witterungsverhältnissen, von Landschaften und bei der präzisen Verortung von Locations aufgefallen. Aber auch die Anomalien werden ungemein konkret beschrieben und wirken manchmal surreal, manchmal aber auch so, als könnte ein solches Phänomen in dieser Form exakt so auftreten. Das ist positiv gemeint und verstärkt die Immersion ungemein.
Ich finde den Schreibstil, gerade für ein Debütwerk, äußerst gelungen. Er wirkt technisch und nahbar zugleich. Er fordert aber auch in jedem Falle konzentriertes Lesen ein – ich wundere mich, dass beim Manuskript kein Verlag zugebissen hat – Plot, Struktur und Pacing sind m.E. herausragend. Ich könnte mir aber vorstellen, dass bei einer Verlagsauswertung der Schreibstil vom Lektorat zugunsten der Eingängigkeit entschlackt werden würde.
Charaktertiefe: Sympathisches, aber irgendwie diffus gezeichnetes Figurentableau
Die Charaktere sind ein zweischneidiges Schwert. Das Figurentableau ist weitgehend grundsympathisch und viele der Charaktere haben eine Backstory, die durchaus taugt, um ihnen jeweils ein geerdetes und realistisches Profil zu verleihen. Man hat zwar schnell das Gefühl, dass die SUP keine moralisch gute Institution ist, aber selbst die Agent*innen der Organisation wirken anfangs noch recht nahbar. Tatsächlich gibt es über einen wirklich langen Zeitraum keine wirklich zentrale Nemesis. Das trägt viel zur diffusen Stimmung bei, die sich zunehmend ausbreitet.
Gleichzeitig bleiben aber auch die Charaktere selbst ein bisschen vage und diffus. Wir bekommen zwar viel von Jans Innenleben mit – aber viel Kante wird trotzdem bei so gut wie keinem Charakter gezeigt. Ich hatte ja schon im Vorfeld erwähnt, dass es wenig zwischenmenschliches Drama gibt, dass um des Dramas willen abgespult wird. Als eine wichtige Figur in Jans Leben auftaucht, werden pro forma die wichtigen Fragen gestellt, es wird ab und zu die Stimme erhoben, und auch das melancholische Gefühl der Entrücktheit wird immer wieder mal ins Bewusstsein gerückt, aber so richtig dringlich fühlt es sich selten an. Jan ist Jan, seine Freunde sind seine Freunde und auch die Beziehung zu Emma dreht sich natürlich irgendwann um die Frage, wie er ihr schonend beibringt, dass er quasi ein Superheld ist. Das typische Superhelden-Origin-Dilemma. Als Emma aber von seinen Fähigkeiten erfährt, passiert im Grunde… nichts. Einerseits umschifft man so Klischeefallen, andererseits plätschern viele Charaktere, obwohl man sie grundsätzlich ins Herz schließt.
Letzteres ist aber das Wichtigste. Man schließt sie ins Herz, und letztlich wirken sie auf diese Weise nicht wie Archetypen, die aus Genre-Trademark-Biografien- und Verhaltensmustern zusammengeschustert sind.
Fazit:
Ich lege Antinomie jedem Leser und jeder Leserin ans Herz, die auf der Suche nach anspruchsvoller Sci-Fi ist. Steffen Vogt hat hier ein gut recherchiertes, spannendes und zugleich herzerwärmendes Debüt veröffentlicht, das Lust auf seinen weiteren Werdegang als Autor macht. Über 54 Kapitel hinweg, entfaltet sich ein Plot, der eine zärtliche, übernatürliche Coming-of-Age Story im Schwarzwald, mit einem global angelegten Agenten-Thriller und einem düsteren Endzeit-Szenario verbindet. Über weite Strecken ist das Erzähltempo vergleichsweise behäbig, kann aber ein hervorragend konstruiertes World Building etablieren, im letzten Drittel zieht die dann Story merklich an. Sicher, die Charaktere können ein paar mehr Kanten und Ambivalenzen zeigen, die Dialoge sind aber geschliffen, die Szenen wunderbar griffig beschrieben. Das ganze Ding hat, wie ich eingangs aufführte, Potential fürs Serienformat. Ein klein bisschen Kritik gibt es an dem fast schon zu cleanen Wohlfühl-Setting im Schwarzwälder Waisenhaus und an ein paar Formulierungen, die ein bisschen straffer und erklärender hätten ausfallen können. Das ist aber Kritik auf ganz hohem Niveau: Ich kann Antinomie voll und ganz empfehlen.
Bei Amazon bestellen:
Steffen Vogt – Antinomie – Ein Techno-Thriller [Gebundene Ausgabe]
Gebundene Ausgabe: 527 Seiten
Verlag: Eigenverlag,
Sprache: Deutsch
ISBN-13: 979-8346150138
Link zu Steffen Vogts Instagram-Kanal: Steffen_Vogt_Autor
Link zur Website: https://www.steffenvogt.com/
Antinomie - Ein Techno-Thriller
Story - 8.2
Charaktertiefe - 7.5
Erzählweise - 8.5
Unterhaltungsfaktor - 9
Schreibstil - 7.5
8.1
Toll geschriebenes Debüt im Eigenverlag, welches hervorragend recherchiert ist, und trotz ruhiger Erzählweise Spannung erzeugt. Gleichzeitig ist der Sci-Fi Thriller durchaus fordernde Kost.