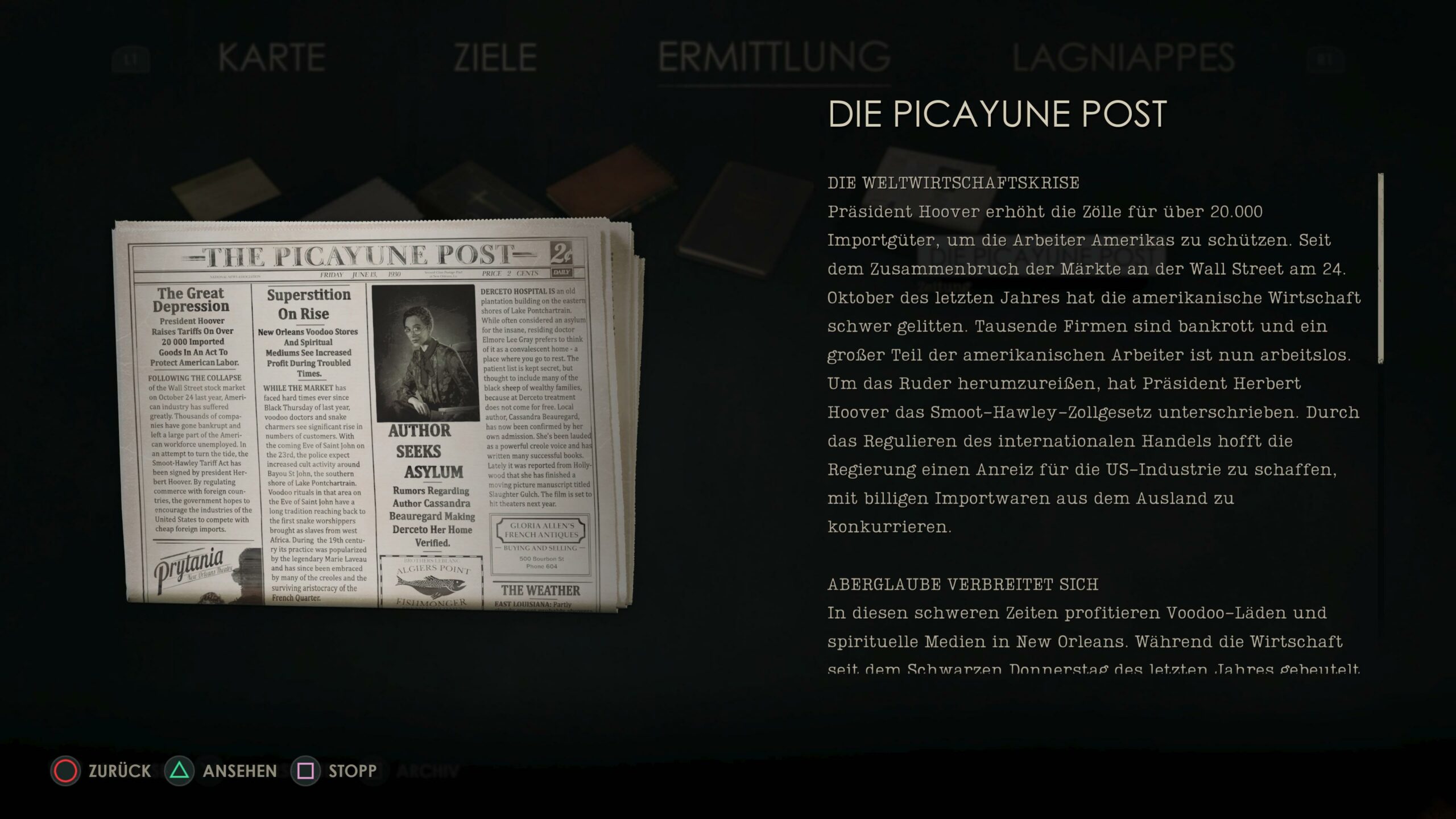Den jüngsten Alone in the Dark Release habe ich tatsächlich von Anfang an mitverfolgt und ihm trotz aller Skepsis auch ein wenig entgegengefiebert – seit dem ersten Leak durch Brancheninsider TheSnitch auf X und seit dem ersten Teaser in Kontext eines THQ Nordic-Showcases habe ich jedes Informationshäppchen zum Comeback der altehrwürdigen Reihe mitgenommen. Und genau das ist auch irgendwo der Grund: Nach dem desaströsen Alone in the Dark Illumination bei ATARI SA war die Reihe jahrelang mausetot und rottete in der Dunkelheit der Franchise-Gräber vor sich hin. Aber auch sonst musste die Reihe, die anno dazumal mit den ersten drei Titeln „modernen“ Survival Horror entscheidend mitprägte, sich einiges gefallen lassen. Alone in the Dark 4: The New Nightmare von 2001 erhielt mit seinem damaligen Next Gen-Einstand auf PS2 und Dreamcast eher gemischte Wertungen, wird retrospektiv aber als mindestens solider Serien-Eintrag wahrgenommen. Das ambitionierte (und m.E. gar nicht soo verkehrte) Reboot von 2008 galt trotz per se guter Schauwerte als Kritiker- und Spieler-Flop, weil es sich einige grobe Design Schnitzer leistete und damit als eher mauer Wiederbelebungsversuch gewertet wurde. Und ausgerechnet der deutsche Meister des schlechten Films, Uwe Boll, hat als Regisseur und später Produzent die beiden grausamen Alone in the Dark-Verfilmungen von 2005 und 2008 zu verantworten. Kurzum: Alone in the Dark hat zwar die ruhmreiche Reputation als Blaupause für Reihen wie Resident Evil, hat den Sprung ins 21. Jahrhundert aber nur bedingt hingekriegt. Umso gespannter war ich, was die Schweden von Pieces Interactive aus der Marke machen. Auch hier war ein gewisses Maß an Skepsis präsent: Pieces haben 2017 mit Titan Quest: Ragnarök ein stilles, unerwartetes und damit komplett überraschendes Add-On zum 2007er Action RPG Titan Quest veröffentlicht, das von Fans gut aufgenommen wurde. 2019 folgte mit Atlantis ein weiteres Add-On für den immerhin 17 Jahre alten Titel. Darüber hinaus aber war das schwedische Studio eher an kleineren Produktionen beteiligt. Würden sie also ein Projekt dieser Größe stemmen können?

Die schwül-warme Southern Gothic-Ästhetik von Alone in the Dark setzt angenehm eigenständige Horror-Trademarks @ THQ Nordic
Es gab Punkte im Marketing-Zyklus, die Hoffnung machten und Punkte, die besorgniserregend waren. Zunächst die positiven Aspekte: Die Fokussierung auf ein Reimagining des ersten AitD Teils mit seinem Southern Gothic-lastigen Setting in Louisiana, New Orleans und dem lovecraftigen kosmischen Horror in Kombination mit Kreol-Kultur und Voodoo – extrem cool! Dass man die Serien Urgesteine, Privatdetektiv Edward Carnby und seine Klientin Emily Hartwood mit David Harbour (bekannt als Hopper aus Stranger Things) und Jodie Comer (bekannt als Villanelle aus Killing Eve) recht hochkarätig besetzt hat – auch ziemlich cool! Dass mit Mikael Hedberg ein versierter Horror-Schreiber am Werk war, der Erfahrung mit narrativen Horror-Titeln wie Soma und Amnesia: The Dark Descent für sich verbuchen kann – auch schön! Auf der Gegenseite hatten wir die nicht wenigen Verschiebungen, die oftmals wenig Anlass zur Hoffnung auf ein gutes Spiel geben: Ursprünglich für September 2023 angesetzt, wurde das Spiel auf Januar 2024 verschoben, damit man nicht zeitgleich mit hochkarätigen Veröffentlichungen wie Baldur’s Gate III, Starfield oder Lies of P konkurrieren musste. Im Januar 2024 schließlich wurde das Ding nochmal nach hinten verschoben, mit der Begründung, dass man das Team während der Weihnachtszeit nicht mit Crunch-Phasen überwältigen wolle. Beide Begründungen sind absolut plausibel, haben immer ein wenig zähes Geschmäckle.
Nun ist Alone in the Dark Ende März erschienen und es ist bemerkenswert … solide geworden. Aber der Reihe nach, in dieser Besprechung erfahrt ihr, warum der rätselhafte Ausflug nach Derceto empfehlenswert und als erneuter Reboot durchaus fortsetzungswürdig ist, warum Alone in the Dark aber auch nicht der ganz große Wurf geworden ist.
Lovecraft‘scher Horror in der sumpfigen Bayou Area des 1930er Louisiana

Ein besorgniserregender Brief von Emilys Onkel Jeremy Hartwood ist Anlass, in der Nervenheilanstalt Derceto im Louisiana der 1930er nach dem Rechten zu sehen… @ THQ Nordic
Die Geschichte von Alone in the Dark wiederzugeben, ist gar nicht mal so einfach: Die grundsätzliche Prämisse ist zwar vergleichsweise simpel gehalten, die Entfaltung der Handlung im Laufe des Spiels lässt sich dann als kompakte Synopsis gar nicht so einfach zusammenfassen. Wir schreiben das Jahr 1930: Emily Hartwood (Jodie Comer) ist die Nichte des genialen, aber gleichsam psychisch labilen Künstlers Jeremy Hartwood. Dieser ist in der Nervenheilanstalt Derceto Manor untergebracht, ein altes Herrenhaus inmitten der sumpfigen Landschaften des Bayou. Als sie einen verstörenden Brief von ihrem Onkel erhält, in welchem er um sein Leben fürchtet, der „Schattenmann“ („Dark Man“) begleite ihn bei all seinen Tätigkeiten, und Derceto sei die Wiege eines willenlosen Kultes, beschließt sie der Sache auf den Grund zu gehen: Gemeinsam mit dem angeheuerten Privatermittler Edward Carnby statten sie dem Derceto Manor einen Besuch vor Ort ab – Doch die nicht gerade freundlich gesonnen Mitarbeiter*innen eröffnen den beiden, dass Jeremy ganz akut irgendwo innerhalb der Institution vermisst werde. Gleichsam tun die Behandelnden der Institution aber wenig daran, die Verdachtsmomente gegen sie aufzuweichen. Im Gegenteil: Sie wirken seltsam dubios und geradezu so, als ob sie ein Geheimnis zu verbergen suchen. Auch die anderen Patient*innen, etwa die von Schreibblockaden geplagte Schriftstellerin Cassandra, das freche Mädchen Grace (welche Hauptprotagonistin des spielbaren Prologs war), der dem Whisky zugeneigte Lebemann und Ex-Boxer McCarfey oder das „verführerische“ Flapper-Girl Ruth sind zwar mindestens interessant, aber sicherlich nicht ohne Laster.

Zu Beginn können wir uns entscheiden, ob wir das Derceto mit Privatschnüffler Edward Carnby oder der Klienten Emily Hartwood durchforsten @ THQ Nordic
Im Laufe der Geschichte erfahren wir, dass das Derceto immer ein Ort kultistischer Verehrung war, und zudem auch Ort immer noch aktiver Voodoo-Praxis. Der Name kommt nicht von ungefähr – In der syrisch-antiken Mythologie war Atargatis eine Fruchtbarkeitsgöttin, die bei den Griechen unter dem Namen Derceto bekannt war. Im Ursprung war das Derceto eine typische Südstaaten Kaffee-Plantage, die von Sklaven beackert wurde. Nach Zerstörung und dem Wiederaufbau war das Anwesen zeitweise eine Enklave für eine Kommunen-artige Künstlergemeinschaft namens Astarte; Auch hier verschwand das Anwesen vermutlich durch eine in den Schriften überlieferte Naturkatastrophe, das Derceto wurde aber als Pflegeheim für die „Mental ermüdeten“ neu erbaut – dieses Mal mit dem Kult um die von Lovecraft geschaffene Gottheit Shub-Niggurath im Hintergrund, die aber menschliche Opfer verlangt.

Das Derceto hatte vielerlei Bestimmungen: Es war Sklaven-bewirtete Kaffeeplantage, eine Enklave für eine Künstlerkommune und schließlich eine Nervenheilanstalt für die „mental ermüdeten“, Immer aber war das Derceto eine Kultstätte @ THQ Nordic
Um die Erweckung Shub-Nigguraths zu verhindern, hat Jeremy Hartwood einen Pakt mit dem vermeintlichen Hirngespinst, dem „Schattenmann“, Nyarlathotep, dem Schwarzen Pharao, geschlossen. Die Schlüssel und letztlich auch sein Aufenthaltsort befinden sich in seinen Erinnerungen und Gedanken, die über portalähnliche Zugänge erschlossen werden können.
Die Story von Alone in the Dark ist im wahrsten Sinne verrätselter psychologischer Horror, denn lange Zeit ist uns gar nicht klar, ob wir es jetzt hier mit echten kosmischen Schrecken zu tun haben, ob der Schwarze Pharao bloß dem Wahn des mental instabilen Jeremy entsprungen ist, und ob auch der hartgesottene funktionale Alkoholiker Inspektor Edward Carnby in Wirklichkeit nicht etwa selbst Patient in der Nervenheilanstalt ist. Was etwa hat es mit dem leeren Zimmer im Derceto auf sich, in welchem wir Hinweise auf unsere eigene Vergangenheit finden? Warum kommt uns das Mädchen Grace so bekannt vor?
Wer die Geschichte nur anhand der Zwischensequenzen spielt, wird gerade gegen Ende reichlich verwirrt sein. Um die Handlung komplett zu erfassen, muss man für einen Survival Horror-Titel recht viel lesen, denn Alone in the Dark ist unerwartet textlastig: Überall finden wir sogenannte „Langniappes“ – ein Begriff aus dem kreolischen Cajun-Französischen, das in der Gegend um New Orleans verwendet wird – und hier im Spiel die Collectibles bezeichnet. Diese sind in Kategorien eingeteilt, und schalten mit je drei Objekten „Verbotenes Wissen“ frei, also weitere Teile der Lore, „Geheime Ziele“, die zu verschiedenen „versteckten“ Enden führen oder mitunter auch spezifische Items oder Bereiche im Derceto Herrenhaus freischalten. Mit fortlaufender Spielstunde werden auch immer mehr Seiten freigeschaltet, die unser Tun in romanhafter Weise prosaisch verarbeiten.

… der uns über Portale mit den Gedanken und Erinnerungen von Jeremy verbindet. Hier etwa ein mexikanisches Kloster, das als mentales Refugium für den gequälten Geist wirkt @ THQ Nordic
Nach dem ersten Durchspielen mit Carnby blieben allerdings noch reichlich Fragen offen – und ich muss zugeben, dass ich trotz des solide inszenierten Finales ein bisschen irritiert und auch ein wenig unbefriedigt zurückgelassen worden bin. Die finalen Kapitel 4 und 5 wirkten eine ganze Spur zu überhastet erzählt, ganz so, als ob ich irgendetwas nicht mitbekommen hätte. Beinahe hätte ich die Story in den Endzügen also ein stückweit abgeschrieben und unter dem Etikett „Cool begonnen, aber enttäuschendes Ende“ verbucht. Erst mit dem zweiten Durchlauf mit Emily Hartwood gab es dann überraschenderweise aber doch noch die großen Aha-Momente, die umso positiver hervorstachen. Es ist also zwingend empfohlen, Emily nicht als kosmetische Ergänzung der Kampagne zu betrachten. Das kann man als Kritikpunkt verstehen, macht aber gleichzeitig auch deutlich, dass beide Figuren gleichwertig bedeutend für die ambitioniert geschriebene Handlung sind.
Die beiden Stränge greifen grundsätzlich gut genug ineinander, als dass sie die Handlung im Gesamten zu tragen vermögen. Insbesondere fand ich es ganz cool, dass die Bewohner des Derceto Manors gänzlich unterschiedlich auf Edward Carnby und Emily Hartwood reagierten, und sich daraus unterschiedliche Situationen ergaben. Edward als rumschnüffelnden und irgendwie abgehalftertem Ermittler wird naturgemäß mit größerem Argwohn begegnet, als der wohlerzogenen Nichte eines bekannten Patienten.
Leider wird das Potential der zwei Charaktere nicht gänzlich ausgeschöpft: Beide Figuren sind parallel zum selben Zeitpunkt im Derceto unterwegs. Die zeitliche Linie der Figuren fühlt sich aber nicht wirklich organisch und authentisch an, weil sie vielfach dasselbe tun müssen – es müssen dieselben Objekte aufgenommen werden, dieselben Rätsel gelöst werden, dieselben Orte in derselben Reihenfolge abgeklappert werden. Zu Beginn etwa müssen wahlweise Emily oder Edward irgendwie ins Anwesen hineinkommen, und der Begleitperson aus dem Innern jeweils die Tür des Vordereingangs öffnen. Je nach Kampagne haben hier beide dieselben Laufwege. Der NPC am Hauseingang wird folglich einfach durch die nicht gewählte Person verkörpert. Hier hätte ich es cooler gefunden, wenn man mit Emily beispielsweise einfach straight das Derceto betreten könnte, weil Edward den „Quasi-Einbruch“ bereits durchgeführt und uns die Tür aufgeschlossen hat. Die dunklen Kellergewölbe haben wir ja ohnehin schon beim ersten Spieldurchgang durchquert. Schlüssel, die bereits im ersten Spieldurchgang genutzt worden sind, stünden uns im zweiten nicht mehr zur Verfügung, stattdessen gibt es für uns andere Rätsel, die visa versa für den anderen Handlungsstrang von Bedeutung wären. Die stärkere Vernetzung der beiden Kampagnen und die sich daraus ergebende Dualität von Erzählung und Gameplay hätte gerade im Derceto als spielerischem Knotenpunkt m.E. wesentlich cleverer und „natürlicher“ gewirkt, zugleich viel schlauchiges Backtracking vermieden worden wäre.
Die „Portal“-Mechanik, mittels derer man in die verschiedenen „Erinnerungen“ von Jeremy hineintaucht bietet zwar erzählerische und vor allem visuelle Abwechslung, ist zugleich aber auch ein wenig plump geraten, weil da das Element des „unzuverlässigen Erzählers“ ein wenig aufgeweicht wird. Die Portale versetzen uns mal in die sumpfig-schwülwarmen Landschaften der Bajou-Region, mal in die kalt-feucht-nebligen Ecken des Hafenviertels von New Orleans, die sich hier ganz klar nach Innsmouth anfühlen, oder aber in eine nächtliche Wüste unter schwarzem Vollmond, wo wir eine versunkene Tempelanlage erkunden. Die Location Wechsel sind erzählerisch nicht besonders clever begründet, der „Erinnerungsansatz“ taugt aber halbwegs.

…andererseits über sogenannte Lagniappes, die Collectibles, die hier aber durchaus klare erzählerische oder spielerische Mehrwerte mitbringen @ THQ Nordic
Aller Kritikpunkte zum Trotz lässt sich aber festhalten: Der literarische, textlastige Ansatz der Erzählung passt hervorragend zur der Lovecraft-artigen Ausrichtung des Spiels, der Southern Gothic-Ansatz, der den kosmischen Horror um kreolische Kultur und Voodoo-Elemente ergänzt, wirkt frisch, wenig abgegriffen und angenehm schaurig und die verschiedenen Enden mit den entsprechend optionalen Konditionen sind auch schön ambitioniert geraten. Für Pieces Interactive hat es sich gelohnt, Hedberg als Autor zu verpflichten. Denn er hat die Essenz „kosmischen Horrors“ m.E. besser verstanden als etwa die Autoren hinter Spielen wie „Conarium“ oder dem bereits genannten „The Sinking City“, deren Writing beileibe nicht schlecht war, mir im direkten Vergleich aber aufgesetzter vorkam, Allerdings würde ich mir wünschen, dass man bei einem möglichen Nachfolger die Kritikpunkte aufgreift, und handlungsmäßig ein „organischeres“ Gesamtbild schafft.
Zwischen Walking Simulator und moderatem Survival Grusel
Die Spielmechanik von Alone in the Dark lässt sich grob in zwei Phasen einteilen: Einerseits durchstreifen wir das düstere Dercato Manor, lesen unzählige Notizen, sammeln Hinweise zur Geschichte des Anwesens, zu den Patientenakten und zu den Geheimnissen, die der Ort birgt. Außerdem müssen wir Schlüsselobjekte zusammensuchen, die relevant für die Bewältigung der zahlreichen Rätseleinlagen sind. Die Rätsel sind in der Regel nicht sonderlich kompliziert aufgebaut: Viele davon sind simple Schalter-Rätsel, manchmal müssen wir auf Basis von verklausulierten Briefen oder Notizen Zahlenkombinationen für unseren Talisman rausfinden, und allzu oft benötigen wir auch schlicht den passenden Schlüssel für das passende Schloss. Die Rätseldesigns sind bei weitem nicht so komplex und hintersinnig wie damals bei einem Silent Hill 2, aber Alone in the Dark greift die verschachtelte Struktur des Ur-Resi-Herrenhauses auf, um klassische Gruselkost zu inszenieren. Dadurch, dass das „weltliche“ Dercato weitgehend keine monströsen Gefahren birgt, spielt sich Alone in the Dark in diesen Momenten eher wie ein behäbiger, auf Erforschung ausgelegter Walking Simulator oder spukige Point and Click-Adventures wie früher The Black Mirror. Wie bereits erwähnt, hätte man die Rätsel mehr mit der Kampagnenstruktur verknüpfen können, und so eine raumzeitliche Komponente mit einbauen können. Das ist ein klassischer Fall verschenkten Potentials.

Der Survival Horror funktioniert recht klassisch – leider ist das Kampfsystem etwas klobig geraten, der Schwierigkeitsgrad hingegen moderat … @ THQ Nordic
Was die Rätsel anbetrifft, sei noch eine spezifische Sache erwähnt: Alone in the Dark bietet neben den klassischen Schwierigkeitsgraden (Einfach, Normal, Schwer) zwei Rätsel-Modi, die den Durchgang wesentlich erleichtern oder erschweren: Beim „Old School“-Modus werden weder Tipps auf der Karte eingeblendet, noch Items In-Game optisch markiert. Man muss sich die Objekte und Derceto sozusagen erarbeiten. Beim „Modernen“ Modus werden lösbare und unlösbare Rätsel auf der Karte markiert, geschlossene Türen gekennzeichnet, aufnehmbare Items über kreisförmige visuelle Highlighter markiert, und auch auf Objekte, mit denen man interagieren kann, wird entsprechend hingewiesen. Diese Zweiteilung find ich eigentlich ganz cool: Beim ersten Spieldurchgang mit Carnby habe ich auf den modernen Stil für die smoothere Erfahrung zurückgegriffen, nachdem ich Derceto aber bereits kannte, habe ich es bei Emily mit dem Old School-Stil probiert und mich sozusagen auf die verinnerlichte Struktur des Herrenhauses verlassen.
Auf der anderen Seite haben wir die klassischen Survival Horror-Passagen, die nicht mehr auf die isometrischen Tank Controls der Vorlage setzen, sondern sich an den moderneren Resident Evil-Remakes mit ihrer Third Person-Shooter-Schulteransicht orientieren: Wir können uns mithilfe verschiedener Schusswaffen, u.a. klassischen 9mm Pistolen, Revolvern, Schrotflinten und Maschinengewehren, aber auch mit verschiedenen Nahkampf-Utensilien gegen die grotesken Monster zur Wehr setzen. Während die Schusswaffen permanent bleiben, sind die Nahkampf-Hieb- und Stichwaffen nur temporär einsetzbar, da sie nach wenigen Hieben und Schlägen zu Bruch gehen. Außerdem können wir herum liegende Molotowcocktails situativ nutzen, um die Kreaturen etwa in Brand zu setzen. Diese können aber nicht ins Inventar aufgenommen werden, sondern müssen an Ort und Stelle „verbraten“ werden, was für mich eine wenig nachvollziehbare Designentscheidung ist, da sie mitunter an eher schwachsinnigen Stellen liegen, die nicht unmittelbarer Teil des Kampfareals sind.
Ganz selten gibt es perspektivische Spielereien, die als Hommage an die klassische Survival Horror-Isoperspektive mit fixen Kamerawinkeln verstanden werden können.

Manchmal gibt es visuelle/perspektivische Spielereien, hier etwa eine Hommage an die alten Tank Controls @ THQ Nordic
Generell ist das Kampfsystem (nebst der Technik) die große Schwachstelle von Alone in the Dark, denn es fühlt sich ähnlich klobig an wie ein anderes jüngeres Spiel mit Lovecraft-Bezügen – nämlich „The Sinking City“ – Das Gunplay hier fühlt sich manchmal ein bisschen zu „wackelig“, mal wiederum ziemlich hüftsteif an, der Nahkampf hat keinerlei Wucht, die Gegner zeigen animatorisch keine nennenswerten Anzeichen, dass sie tatsächlich getroffen wurden. Das fehlende Trefferfeedback ist hierbei die größte Schwäche, die ich an Alone in the Dark kritisiere, es gibt aber durchaus auch noch andere Wehwehchen: Es gibt recht wenige Gegnertypen, von denen einige mit recht coolen, durchaus fiesen Designideen aufwarten, die restlichen aber eher generisch lovecraftig, also irgendwie maritim, anmuten. Manchmal versucht uns das Spiel zu vermitteln, dass es sich lohnen würde, die eher unnötigen Stealth-Mechaniken zu nutzen, um uns an Gegnern vorbeizuschleichen. Das macht aber weitgehend nur wenig Sinn: Denn erstens ist die Gegner-KI eh ziemlich dumm und bekommt wenig mit, zweitens bekommen wir auf normalem Schwierigkeitsgrad nur wirklich selten Probleme in Form von Munitionsmangel, da es diese wirklich überall zu finden gibt, und wenn es doch mal knapp werden sollte, können wir uns irgendwo eine Schaufel oder einen Spaten greifen, und blind um uns kloppen, wird schon treffen und tut es meist auch. Nur ganz selten gibt es Momente, wo uns das Spiel derart viele Monster auf den Leib hetzt, dass Flucht die bessere Wahl ist.
Und so wird es eigentlich nur dann problematisch, wenn Gegner durch Bugs nicht aufhören nachzuspawnen oder einfach in Areale clippen, wo sie eigentlich nicht sein sollten. Das passiert zwar tendenziell selten, aber es kommt durchaus vor.
Durch den moderaten Schwierigkeitsgrad („Normal“ als Referenz) lässt sich Alone in the Dark aber auch von Leuten gut spielen, denen Resi, Silent Hill und co. sonst zu schwer sind, welche aber dafür Lust auf klassische Grusel Adventures haben.
Stilsicheres Art Design, durchwachsene Optik, einige technische Ungereimtheiten
Visuell ist Alone in the Dark ein enorm zweischneidiges Schwert, das mich oft an andere AA-Horror-Titel der jüngeren Zeit, etwa The Chant oder The Medium, erinnert hat: Die künstlerische Ausrichtung ist auch hier konsequent durchgezogen und stilsicher, an der Technik und Performance hapert es dann aber leider.
Die Gestaltung von Derceto Manor, dieser prunkvollen Nervenheilanstalt in den sumpfigen, schwülen Landschaften von Louisiana ist klares Highlight. Die opulente Ausstattung, die immer leicht gedimmten Lichtstimmungen, und der 1930er Look des Spiels setzt visuell eine ganz eigenständige Duftmarke im Horror-Genre. Im späteren Verlauf setzt kurz vor einem vorbereiteten Ritual ein Hitzegewitter ein, welches das dunkle Anwesen sporadisch erhellt, und für wohlige Gruselstimmung sorgt.
Durch die Portale werden Szenerie Wechsel getriggert, die für optische Abwechslung sorgen: Wir besuchen das Französische Viertel von New Orleans in der grünlich-vernebelten Abenddämmerung; den „Hasserfüllten Hügel“ im ländlichen Bayou, der Standort einer Ölbohrplattform ist; eine sonnendurchflutete Klosteranlage in Mexiko, die als Jeremy Hartwoods geistiges Refugium herhält; die Pearl River Brücke, die auch in einer sumpfigen Landschaft angesiedelt ist; wir ermitteln in einem heruntergekommenen Hafenviertel an einer merkwürdigen Adresse die Hintergründe des „Schwarzen Pharaos“, bergen die Geheimnisse eines im Sand versunkenen Wüstentempels und untersuchen monumentale Relikte in der Antarktis. Was davon Wahn ist, was davon real, das wird nie ganz klar. Aber es macht Spaß, diese Abschnitte zu erkunden.
Die den namhaften Schauspieler*innen Jodie Comer und David Harbour nachempfundenen Hauptprotagonisten und auch eine Reihe der anderen NPCs sehen mit Blick auf die Charaktermodelle ganz hübsch aus, weil sie mit netten zeitgemäßen Details versehen sind.
Die Charaktere entsprechen allesamt klassischen Archetypen des Noir Film-Genres und sind entsprechend charakterisiert mit entsprechender visueller Gestaltung.

Alone in the Dark arbeitet mit Archetypen des Noir – Mit Ruth haben wir etwa das klassische Flapper-Girl @ THQ Nordic
Die Animationen sind allerdings leider oft ziemlich steif geraten, gerade das Ausweichen und das Schleichen sieht furchtbar aus. Die mit Motion Capturing aufgenommenen Gesichtsanimationen wirken ein wenig „befremdlich“ (klassischer Fall von „Uncanny Valley“), weil sie gleichzeitig realistisch modelliert, aber eher mittelmäßig animiert wurden. Die NPCs (also vordergründig die Patienten des Derceto) sind von diesem Manko noch eine Ecke mehr betroffen. Das scheint aber eben eine klassische Krankheit von ambitionierten Titeln mit AA-Budget zu sein, und auch hier schiele ich wieder zu The Chant, zu The Medium, The Sinking City, die mit denselben Problemen zu kämpfen hatten.
Alone in the Dark kann durch die 1930s Louisiana Southern Gothic-Ästhetik viele Schwächen kaschieren. Denn trotz einer ganzen Fülle eher schwach texturierter Details, platt wirkendem Nebel, limitierten Animationsphasen und wenig Möglichkeiten der Umgebungsinteraktion, hat mir der Voodoo-Spuk visuell ganz gut gefallen.
Weitaus weniger Geduld hatte ich mit den vielen technischen Bugs, die mal mehr, mal weniger schwerwiegend ausfielen: In einigen Teilen des Spiels, etwa im Hafenareal oder im Tempel, bleiben unsere Spielfiguren viel zu gerne an willkürlichen Objekten kleben. In der Regel konnte ich mich zwar durch buttonmashende „Ausweichmanöver“ aus der Lage retten, ein paar Mal musste ich aber schlicht neu laden, weil es nicht anders ging.

Es gibt schön fiese Gegnerdesigns, dieses generische Vieh gehört aber nicht zu der illustren Runde @ THQ Nordic
Die Clipping- und Respawn-Bugs bei Kampfsequenzen habe ich ja bereits im Vorfeld erwähnt. Ein besonders merkwürdiger Bug tauchte bei der Pearl River Bridge auf: Oberhalb der Brücke greifen fliegende Fledermaus-ähnliche Kreaturen an und zwar in einer Menge, dass man tatsächlich auf eine untere Ebene fliehen muss. Das Spiel ist darauf ausgelegt, dass die Fledermäuse aufhören anzugreifen, sobald man unten am Fluss angekommen ist. In meinem Spieldurchgang griffen die Fledermäuse aber beharrlich weiter an. Das Spiel kam offenbar mit den nachladenden Monstern nicht klar, der ganze Sound brach zusammen, es bildeten sich grafische Artefakte, Störgeräusche dröhnten aus den Lautsprechern, bis das Spiel schließlich abschmierte. Auch bei erneuten Laden blieb dieser Fehler bestehen, sodass ich mit einem früheren Speicherstand vorliebnehmen musste. Ein anderer Fehler, der wiederholt auftrat, war, dass bereits eingesammelte Langniappes teils einfach verschwanden. Das ist insofern problematisch, weil man mit den Collectibles teilweise die versteckten Enden freischaltet. Hier ist zu hoffen, dass THQ Nordic und Pieces Interactive diese Probleme dringend mit entsprechenden Patches beheben.

Ich hätte mir gewünscht, dass sich die Laufwege bei den beiden spielbaren Hauptfiguren unterscheiden, und so mehr raumzeitliche Parallelität bei der Erforschung des Derceto gegeben wäre @ THQ Nordic
Grandioser Doom Jazz-Soundtrack und tolle deutsche Sprecherleistungen
Ein ziemliches Highlight von Alone in the Dark ist der grandiose Soundtrack. Dieser entstammt der Feder des niederländischen Musikers Jason Köhnen in Zusammenarbeit mit dem isländischen Komponisten Árni Bergur Zoëga. Zusammen haben die beiden einen Doom/Dark Jazz-artigen Sound für das Spiel geschaffen, der hervorragend zum düster-verspielten Louisiana-Horror des Spiels passt. Witzigerweise hat Jason Köhnen mehrere Dark Jazz-Projekte begründet, die ebenfalls aus dem Lovecraft-Oeuvre schöpfen, u.a. The Lovecraft Sextett.
Der hier gespielte Doom Jazz erinnert ein bisschen an den Twin Peaks-Soundtrack von Angelo Badalamenti – die loungigen Jazz-Spielereien werden um düster-bedrohliche Klangarrangements ergänzt, die eine surreal-soghafte Atmosphäre erzeugen. Langsame Drums verbinden sich mit in die Leere kreischende Saxophon-Tönen. Das passt super und wirkt wieder angenehm eigenständig. Ich habe mich auch an den Soundtrack des chinesischen Rollenspiels Mato Anomalies erinnert gefühlt, der auf ähnliche Versatzstücke zurückgriff.
Die Sprecherleistungen der Figuren sind auf Deutsch qualitativ ziemlich hochwertig und lassen wenig Raum für Kritik. Auch die Erzählerstimmen, welche die Texte vortragen, passen gut. Ich habe zum Vergleich auf die englische Sprachausgabe gewechselt, die ich in diesem Fall tatsächlich als wesentlich schlechter empfunden habe. Insofern dürfen sich deutsche Spieler*innen auf eine hochwertige Lokalisierungsarbeit freuen.
Fazit:
Ich halte den Reboot von Alone in the Dark summa summarum für recht gelungen und fortsetzungswürdig. Mir hat das unverbrauchte Southern Gothic-Setting gefallen, die Lovecraftige Ausrichtung wird durch eine gut geschriebene Story getragen. Und der eher behäbige Erzählton tut dem Spiel auch ganz gut und passt zum rätsellastigen Erkundungs-Part. Alone in the Dark erzählt eher ein klassisches Schauermärchen, weniger ein goriges Horror-Spektakel. Es freut mich, dass Pieces Interactive sich im Großen und Ganzen NICHT übernommen haben, sondern das wohl beste Alone in the Dark seit den 90ern geschaffen haben. Ein richtig runder Titel ist es aber trotzdem nicht, denn die Kritikpunkte wiegen vergleichsweise schwer: Obwohl der künstlerische Stil über vieles hinweg kaschieren kann, reißt AitD in grafischer Hinsicht alles andere als Bäume raus. Zu detailarm sind viele Texturen, zu klobig die Animationen. Etwas klobig ist auch das trefferfeedbackarme Kampfsystem geraten, welches oft an einen anderen Titel mit Lovecraft-Vorlage erinnert: The Sinking City. Die nicht wenigen und stellenweise auch nicht ungravierenden Bugs müssen aber dringend per Patch behoben werden.
Bei Amazon bestellen:
Alone in the Dark [PlayStation 5]
Alone in the Dark [Xbox Series S|X]
Bei Steam kaufen:
Alone in the Dark [PlayStation 5]
Grafik - 6.9
Story - 8.2
Technik - 5.1
Umfang - 7.5
Spielspass - 7.2
7
Das wohl beste Alone in the Dark seit den 90ern - Ganz sicher nicht frei von Schwächen, aber angenehm eigenständiger Horror-Titel, der fortsetzungswürdig ist.